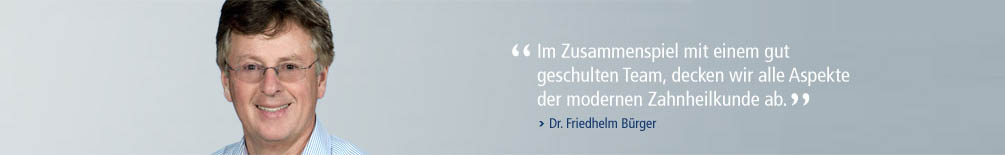Berufspolitik
Jeden Tag sterben in Deutschland und somit auch in Rheinland-Pfalz Menschen, die eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) benötigt hätten, diese aber nicht bekommen haben, weil Krankenkassen hierfür keine Verträge mit Versorgungsteams abschließen.
Und dies obwohl die rechtliche Grundlage klar ist: Der Anspruch auf Verbesserung der ambulanten Palliativtherapie wurde in Deutschland in Form der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) am 1. April 2007 im SGB V § 37b gesetzlich verankert. Seitdem gibt es SAPV in Deutschland. Die Richtlinie zur Umsetzung des Gesetzes des Gemeinsamen Bundesausschusses trat etwa ein Jahr später am 11.03.2008 in Kraft. Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen verabschiedeten am 28.06.2008 ihre Rahmenempfehlung zur SAPV. Damit gilt: Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf SAPV.
Es gibt aber nach wie vor Krankenkassen, die keine SAPV-Verträge schließen. Bisher wurden in neun Bundesländern auf Landesebene Mantel-Verträge zur SAPV abgeschlossen; in 13 Bundesländern gibt es vertraglich anerkannte SAPV Teams, in drei Bundesländern gibt es noch keinerlei Verträge beziehungsweise Anerkennung von spezialisierten Palliativteams durch die Kassen. Rheinland Pfalz gehört dazu (Stand Oktober 2010) (1).
Was ist SAPV?
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung gemäß § 37b SGB V dient dem Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern, zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung oder in stationären Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. Sie ergänzt das bestehende Versorgungsangebot, insbesondere das der Vertragsärzte, Krankenhäuser und Pflegedienste. Im Vordergrund steht anstelle eines kurativen Ansatzes die medizinisch-pflegerische Zielsetzung, Symptome und Leiden einzelfallgerecht zu lindern.
Versicherte haben Anspruch auf SAPV, wenn sie an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und so weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden, dass dadurch ihre Lebenserwartung begrenzt ist und sie eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, das heißt wenn ein komplexes Symptomgeschehen vorliegt wie etwa ausgeprägte Schmerzen, Luftnot, problematische exulzerierende Wunden, psychische / neurologische Problematik, besonders ausgeprägte gastrointestinale oder urogenitale Symptome. (2).
Wenn in solchen Fällen die ambulante ärztliche oder pflegerische Versorgung an fachliche oder personelle Grenzen stößt und die Klinikeinweisung eines Patienten droht, ist die Hinzunahme eines spezialisierten Teams sinnvoll, um den Verbleib zu Hause zu sichern. Das Gleiche gilt, wenn die Familie, die den Schwerstkranken pflegt, die psychische Belastung durch die Krankheit und den nahenden Verlust ihres Angehörigen nicht mehr alleine tragen kann. Wesentliche Bestandteile der SAPV sind deshalb Beratung, Anleitung und Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen in medizinischen und pflegerischen Belangen, Unterstützung beim Umgang mit Sterben und Tod, sowie spezialisierte Beratung des behandelnden Hausarztes beziehungsweise Pflegedienstes.
SAPV muss ärztlich verordnet werden
SAPV muss ärztlich verordnet werden (KV-Muster 63) vom Hausarzt, von einem anderen Facharzt oder einem Klinikarzt und umfasst vier Leistungsstufen (Beratung, Koordination, Teilversorgung und Vollversorgung im Sinne der Symptombehandlung). Es ist eine Komplexleistung, die von einem Palliativteam erbracht wird. Ein Palliativteam besteht aus erfahrenen Palliativmedizinern, in Palliative Care ausgebildeten Pflegekräften, einem Koordinator und verschiedenen Kooperationspartnern, dazu zählen vor allem der ambulante Hospizdienst, aber auch Seelsorger, Sozialarbeiter, spezialisierte Physiotherapeuten und Psychoonkologen.
Nach dem Erstassessment durch einen Palliativmediziner und durch eine Palliative Care Kraft werden in der Teambesprechung ein individueller Hilfs- und Notfallplan für Krisensituationen erstellt und dem Hausarzt wie dem Pflegedienst mitgeteilt beziehungsweise diskutiert. In wöchentlichen Monitoring-Besuchen wird der Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen überprüft und innerhalb des Palliativ-Teams aber auch mit dem Hausarzt besprochen. Die Palliativteams verpflichten sich darüber hinaus, eine 24-Stunden / 7-Tage-Ruf-, Notfall- und Kriseninterventionsbereitschaft für die in die SAPV eingeschriebenen Patienten vorzuhalten. Und sie müssen in der Lage sein, gegebenenfalls Medikamentenpumpen und notwendige Hilfsmittel unverzüglich bereitstellen zu können.
Die Entwicklung in Rheinland Pfalz
Am rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium entstand im Zuge der Umsetzung des Gesetzes bereits im Juni 2007 der Arbeitskreis Palliative Care. Zu dieser lockeren Gesprächsrunde gehören unter anderem Vertreter der interdisziplinären Gesellschaft Rheinland Pfalz, der Liga der Wohlfahrtsverbände, der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz, der privaten und kommunalen Pflegedienste, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Hausarztverband RLP sowie der Krankenhausgesellschaft moderiert von einem Referenten des Ministeriums. Dieser Arbeitskreis mühte sich zunächst um Begriffsbestimmungen, um Qualitätskriterien für Palliativteams, später auch um Flächen- und Strukturentwicklungen der Palliativversorgung mit Blick in die Zukunft.
Daneben bildete sich im August 2007 der Arbeitskreis Netzwerk Palliativmediziner Rheinland Pfalz. In diesen Sitzungen standen praktische Fragen zur konkreten Umsetzung der SAPV im Vordergrund. Die Informationen aus der ministerialen Arbeitsrunde wurden diskutiert und die dann notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau eines Palliativteams besprochen. Lange Zeit war dieser Kreis ein lebendiges Forum, in dem sich Palliativmediziner aus allen Regionen unseres Bundeslandes trafen: von Trier über Ahrweiler, aus der Region Westerwald, Mainz, Ludwigshafen, Landau bis Pirmasens. Beim ersten Landestreffen der Palliativmediziner im September 2008 wurde beschlossen, dass die interdisziplinäre Gesellschaft für Palliativmedizin Rheinland Pfalz (iGP) das Mandat der rund 120 dort engagierten Ärzte erhält und die SAPV in ihrem Sinne verhandeln und umsetzen soll.
Findungsphase braucht sehr viel Zeit
Politische Entwicklungen und deren Umsetzung brauchen bekanntermaßen ihre Zeit. Die Krankenkassen beispielsweise wurden im November 2008 in den Arbeitskreis am Ministerium eingeladen und machten zunächst eine Findungsphase durch: untereinander und mit dem Arbeitskreis Palliative Care. Es entstand der Eindruck, dass sich in Rheinland-Pfalz die Vertreter der Kassen bis dato kaum mit dem Thema SAPV beschäftigt hatten, obwohl seit 2007 der gesetzliche Sicherstellungsauftrag an sie erfolgt ist. Trotz des öffentlich erklärten Willens, die gesetzlich festgelegten Leistungen ihren Versicherten anzubieten, waren nur sehr zögernde Fortschritte in der Annäherung an die Begriffsinhalte der SAPV und deren Umsetzung in die Praxis zu erkennen.
Am 01. Januar 2009 liefen die in der Bundesrepublik bestehenden I.V.-Ver-träge zur Palliativversorgung aus. Als daraufhin in Westfalen-Lippe (April 2009) und in Hessen (Mai 2009) die ersten Einzelverträge zur SAPV abgeschlossen wurden kam auch in Rheinland-Pfalz mehr Bewegung in die Gespräche im Arbeitskreis Palliative Care. Die Kassen erklärten sich bereit, in Rheinland-Pfalz einen Mantel-Vertrag gemeinsam zu erarbeiten also nicht jede Kasse für sich, sondern alle gemeinsam. Es dauerte noch bis August 2009, bis sich eine Verhandlungsrunde formierte, bestehend aus den Mandatsträgern der Palliativteams (beauftragte Vertreter der Interdisziplinären Gesellschaft für Palliativmedizin Rheinland Pfalz (iGP), der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz (LAG) und den Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen RLP. Der erste Entwurf für den SAPV-Vertrag wurde dann im September 2009 von den Kassen vorgelegt; erst im Dezember 2009 fand die erste Verhandlungsrunde statt.
Die Inhalte des Vertrages sind durch die SAPV-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses weitgehend vorgegeben; in den Nachbarbundesländern lagen schon Verträge vor, mit denen SAPV-Teams bereits ihre Arbeit aufgenommen hatten. Trotzdem war es nicht einfach, gemeinsame konsensfähige Formulierungen zu finden. In den folgenden sechs Monaten wurde in etlichen Sitzungen ein Leistungsmodell entwickelt, auf dessen Grundlage von Seiten der Palliativteams eine detaillierte betriebswirtschaftliche Kalkulation erstellt und den Kassen als Diskussionsgrundlage vorlegt wurde.
Dazu kam es jedoch zunächst nicht. Im April 2010 erfolgte bei der AOK ein Wechsel der Verhandlungspartner, und es wurde ein völlig neues Leistungsmodell auf den Tisch gelegt. Damit waren die Gespräche und Fortschritte der vergangenen Monate fast auf den Nullpunkt zurückgesetzt worden. Die Kassen waren weiterhin auch im neuen Leistungsmodell nicht bereit, intensiv in die notwendige Diskussion um Leistungsinhalte und Arbeitszeiten einzusteigen (Es geht um Preise, nicht um Leistungen und Minuten). Die Vergütungsangebote der Kassen lagen anfangs so weit unter einem kostendeckenden Niveau, dass am 18. Mai die Verhandlungen von Seiten der Palliativteams abgebrochen werden mussten, da auf dieser Basis keine Aussicht auf Einigung bestand. Die Vertretung der Palliativteams wandte sich mit der Bitte um Unterstützung an die Gesundheitsministerin, die ihr großes Interesse an einer zügigen Umsetzung des Gesetzes bekundete.
Es geht schleppend wieder rückwärts
Ende Juli wurden die Gespräche wieder aufgenommen. Die Vorsitzende des Arbeitskreises Palliative Care am Ministerium, Frau Dr. Heinemann, ist seitdem als Beobachterin dabei. Von Seiten der AOK kam der Vorsitzende in die Verhandlungsrunde dazu. Die Gespräche machten im August zähe, aber dennoch Fortschritte. Jetzt (Ende November 2010) sind die Verhandlungen dort, wo sie im Mai schon mal waren. Ganz entgegen dessen, was damals zu hören war, werden jetzt Betreuungsminuten einzeln betrachtet und diskutiert. Es geht schleppend wieder rückwärts. Es hat den Anschein, dass die Kassen weiterhin die Taktik verfolgen: Gut Ding will Weile haben.
Das Gesetz zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung bietet unheilbar kranken Menschen Hilfe in ihrer letzten Lebensphase. Berechnungen gehen davon aus, dass sieben bis acht Prozent der Sterbenden pro Jahr eine SAPV benötigen. In Rheinland-Pfalz sind das somit etwa 3200 Fälle. Anders gesagt: auf 250.000 Einwohner kommen jährlich etwa 200 Menschen mit Anspruch auf SAPV.
Bereits seit mehr als einem Jahr bieten einige Palliativteams in Rheinland-Pfalz Hausärzten und Pflegediensten ihre Unterstützung bei der häuslichen Versorgung dieser Schwerstkranken an mit viel persönlichem Engagement und bis dato einer ungewissen adäquaten Vergütung.
Der gesetzliche Anspruch der Versicherten besteht zwar, der Sicherstellungsauftrag der Kassen ist klar, die Kostenerstattung der erbrachten Leistung ist einklagbar aber kaum ein Patient, der in kurzer Zeit sterben wird und unter starken Beschwerden leidet, hat noch die Kraft, das vor Gericht einzufordern.
Den Kassen fehlt für SAPV anscheinend der Entscheidungswille
Viele motivierte Palliativmediziner und Palliative Care Pflegende, die das seit 3,5 Jahren geltende Gesetz dennoch selbstlos umsetzen, sind nicht mehr lange bereit und in der Lage unter diesen Bedingungen SAPV zu erbringen. Sie leisten zurzeit praktisch ehrenamtlich eine hochqualifizierte Patientenbetreuung und 24 Stunden Nacht- und Wochenend-Rufdienste. Die Anerkennung der Leistung der Teams seitens der Kassen ist praktisch Null, die Vergütung fraglich vielleicht erst nach einem Gerichtsprozess.
Die entstehende Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung bietet die Möglichkeit einer neuen ambulanten Vernetzung und Bildung professionenübergreifender Teams und verbessert damit nicht nur die Versorgungsqualität, sondern schafft Strukturen, die wir in Zukunft bei abnehmenden Zahlen an Ärzten und Pflegekräften und zunehmenden Patientenzahlen brauchen. Zur Umsetzung des Gesetzes fehlt es im Moment an Entscheidungswillen und Weitblick von Seiten der Kostenträger. Diese Entscheidungen müssen auch in unserem Bundesland bald fallen.
Der Autor ist Palliativmediziner und Sprecher der Sektion Ärzte für die iGP-Rheinland Pfalz
Quellen:
1) Arbeitsgemeinschaft Spezialisierte Ambulante PAlliativVersorgung Internet: ag-sapv.de
2) Gemeinsamer Bundesausschuss Richtlinie zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung
(SAPV Richtlinie) BAnz. Nr. 39 (S. 911) vom 11.03.2008 Letzte Änderung: 15.04.2010 BAnz.
Nr. 92 (S. 2 190) vom 24.06.2010